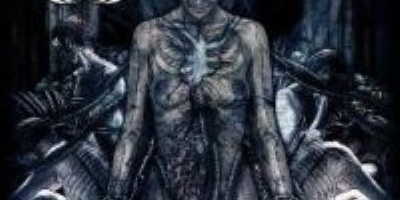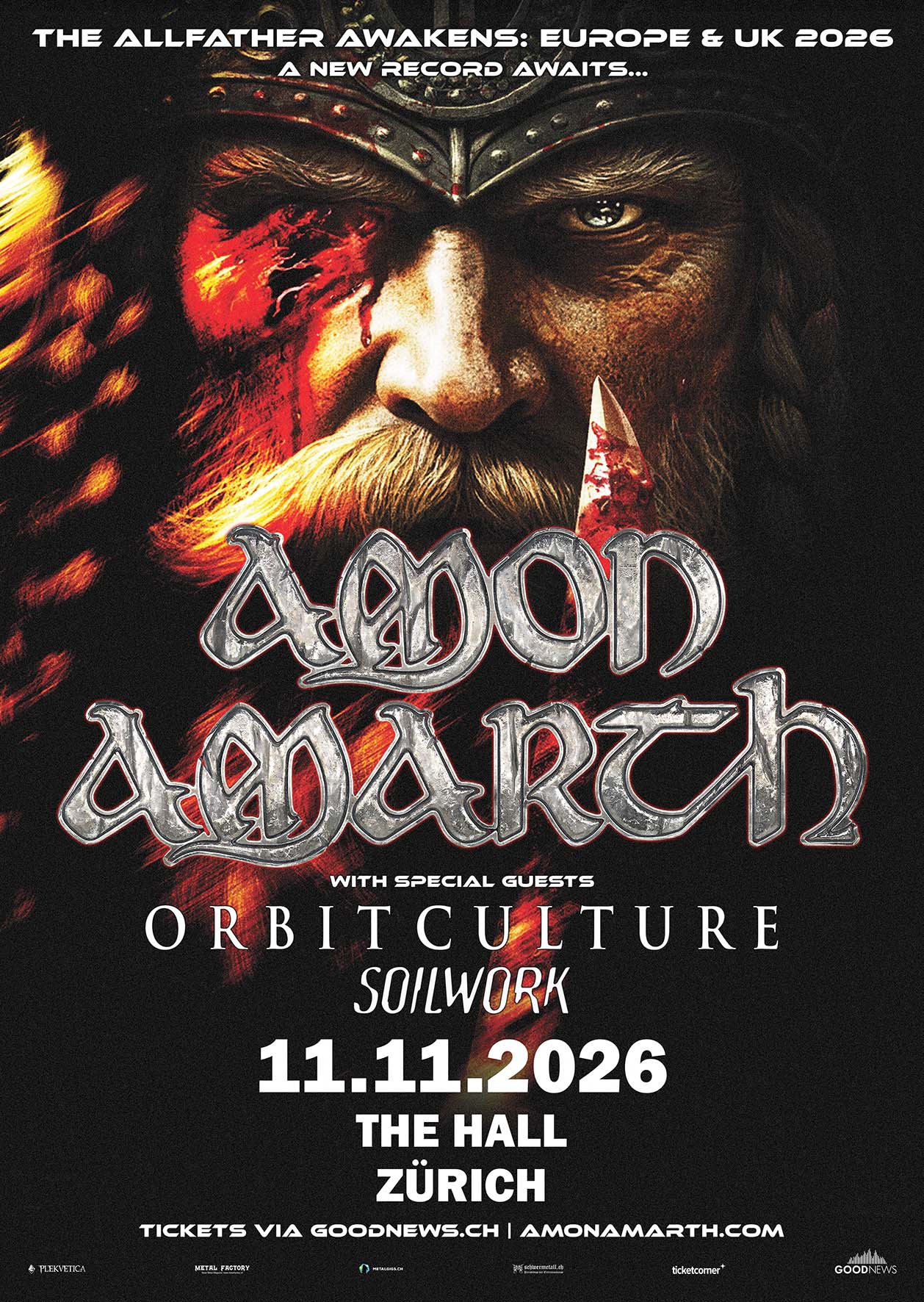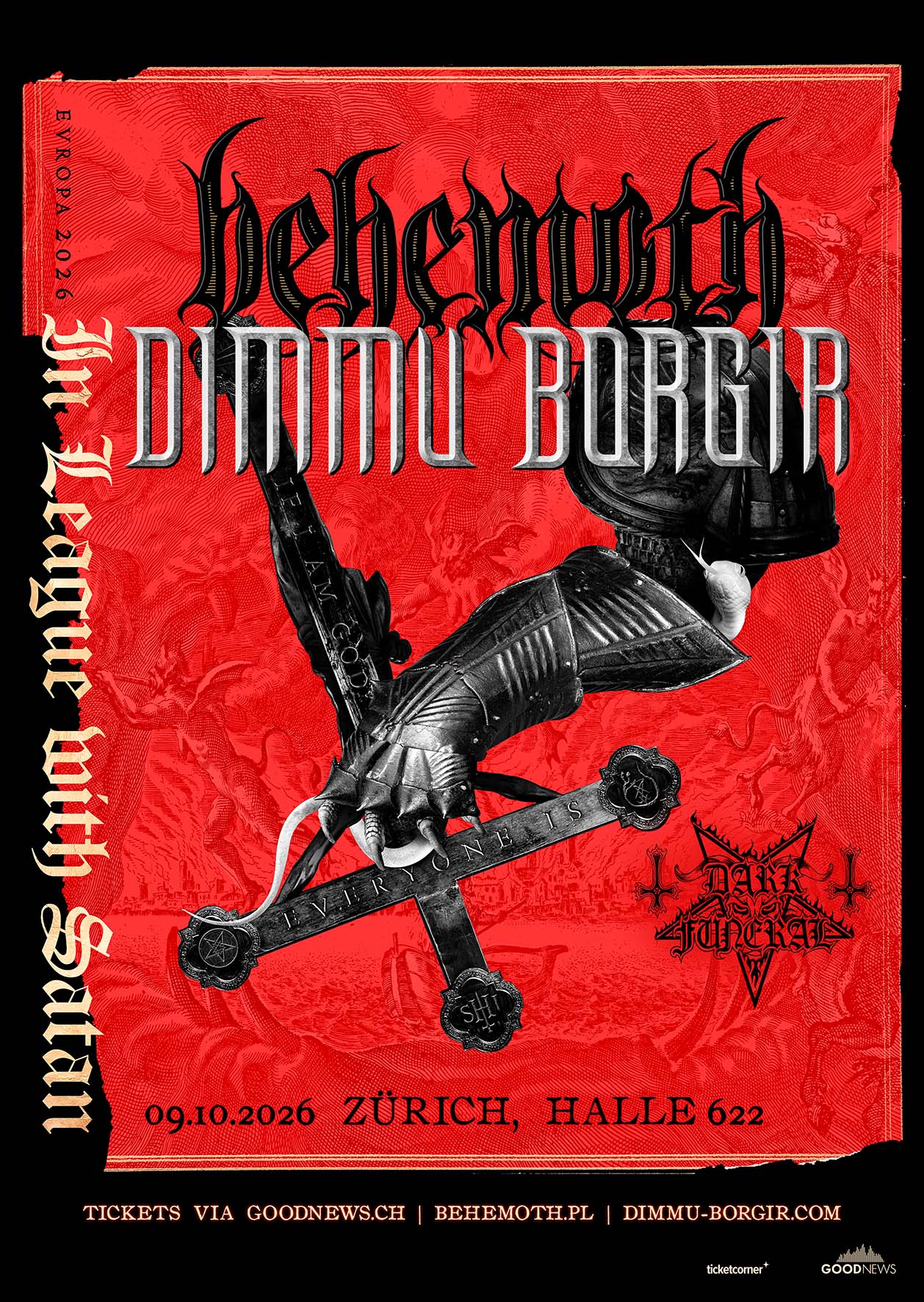Es gibt Momente, in denen Musik weit über den bloßen Klang hinausgeht, in denen sie zu einem emotionalen Monument wird, das uns zwingt, in den dunkelsten Winkeln unserer Existenz zu verweilen...
Es gibt Momente, in denen Musik weit über den bloßen Klang hinausgeht, in denen sie zu einem emotionalen Monument wird, das uns zwingt, in den dunkelsten Winkeln unserer Existenz zu verweilen. Bonjour Tristesse hat mit ihrem vierten Album, "The World Without Us", genau das erreicht. Ein Werk, das nicht nur aus Riffs, Melodien und Texten besteht, sondern vielmehr eine intime Auseinandersetzung mit der Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz und der unvermeidlichen Rückkehr der Natur darstellt.
Nathanael, der kreative Kopf hinter diesem Projekt, taucht tief in die düsteren Themen der Entfremdung und Zerstörung ein, und sein musikalischer Ausdruck ist ebenso schmerzhaft wie erhaben. Mit jedem Stück erschafft er eine Atmosphäre, die von Melancholie und Verzweiflung durchzogen ist, und führt uns in eine postapokalyptische Welt, in der die Natur sich unaufhaltsam das zurückholt, was der Mensch ihr genommen hat.
Doch was treibt diesen Einzelgänger der Black-Metal-Szene an, solch beklemmende und gleichzeitig tief bewegende Klangwelten zu erschaffen? Wie sieht er die Beziehung zwischen Mensch und Natur, und wie verarbeitet er diese Themen in seiner Kunst? Im folgenden Interview tauchen wir in die Gedankenwelt von Nathanael ein und erfahren mehr über den kreativen Prozess hinter "The World Without Us", seine Ansichten zur menschlichen Hybris und die Schönheit, die in der Dunkelheit liegt.
Du hast den Namen Bonjour Tristesse gewählt, der sowohl von einem Gedicht von Paul Éluard als auch von einem Roman von Françoise Sagan stammt. Inwieweit spiegelt dieser Titel deine künstlerische und philosophische Grundhaltung wider, und welche Bedeutung hat „Traurigkeit“ als emotionales Leitmotiv in deiner Musik?
Als ich den Roman von Françoise Sagan vor fast 20 Jahren zum ersten Mal las, war ich von der eigenartigen, melancholisch düsteren Stimmung fasziniert. Vor dem eigentlichen Text war das Gedicht „A Peine Défigurée“ von Paul Éluard abgedruckt, welches mich sofort durch seine poetische Kraft in den Bann gezogen hat. Éluard war im Widerstand gegen die Nationalsozialisten aktiv, was ich äußerst interessant fand. Ich begann mich mit ihm und seinen Texten zu befassen. Die Melancholie und der Kampfgeist, die widerständige Unbeugsamkeit und die kompromisslose Haltung passte perfekt zu dem was mir in Sachen Black Metal vorschwebte.
„Bonjour Tristesse“ war der perfekte Name für die Band. Traurigkeit ist die Grundstimmung und tatsächlich das emotionale Leitmotiv der Band. Es gibt wütende, verzweifelte, hasserfüllte und hoffnungsvolle Bonjour Tristesse Stücke, traurig sind sie aber letztendlich alle.

Wenn du auf die Entwicklung von Bonjour Tristesse seit der Gründung zurückblickst – was waren die prägendsten Momente für dich und wie haben sie die Band und deine Musik beeinflusst?
Ich schrieb die ersten Songs 2008. Damals war Black Metal für mich die kraftvollste und emotional bewegendste Musikrichtung überhaupt (das sehe ich eigentlich auch immer noch so). Prägend war dann allerdings auch, dass ich um 2012 nur mehr geringe Motivation hatte weiter in der Black Metal Szene aktiv zu sein, da ich keine Lust auf Auseinandersetzungen mit Nazis hatte. Nach einer zweijährigen Band-Pause hatte ich beschlossen, dass man Dinge bzw. eine Szene nur dann verändern kann, wenn man selbst auch aktiv wird. Ich beschloss daher Bonjour Tristesse fortzuführen und ein Gegengewicht gegen die politisch fragwürdigen Teile der Szene zu etablieren.
Wichtig war im Anschluss daran auch, dass ich 2014 von MDD Records kontaktiert wurde, die das Debutalbum „Par un sourire“ von 2010 auf Vinyl veröffentlichen wollten. Ich nahm einige zusätzliche Gitarren auf und das Album wurde neu gemischt und gemastert. Die Veröffentlichung hat frischen Wind in die Band gebracht und ich begann verstärkt an den begonnen Songs für das zweite Album „Your ultimate urban nightmare“ zu arbeiten. Wichtig war dann natürlich die Zusammenarbeit mit Lifeforce Records und Supreme Chaos Records. Ich verdanke den beiden Labels bzw. Stefan und Robby, viel. Während der Pandemie schrieb ich zwei weitere, rohere und wenn man so will „truere“ Alben, „Against Leviathan“ und „The world without us“. Die Motivation ist seitdem ungebrochen.
Wie gestaltest du den kreativen Prozess, wenn du ein neues Album für Bonjour Tristesse schreibst? Gibt es bestimmte Rituale, Emotionen oder Orte, die dir dabei helfen, die düstere Atmosphäre und tiefgehenden Themen deiner Musik zu erschaffen?
Als kritisch denkender Mensch findet man in unserer Welt überall Missstände und Elend – auch im weitgehend wohlsituierten Mitteleuropa. Ich kann daher gar nicht anders, als diese vielfältigen Eindrücke in meiner Musik zu verarbeiten. Der Status quo in der fortschrittsgläubigen, der Technik verfallenen, industrialisierten Zivilisation führt seit dem Beginn der Landwirtschaft, und verstärkt seit der Industrialisierung, zur Vernichtung der natürlichen Welt. Die dem „Humanismus“ innewohnende Arroganz bzw. seine egoistische Seite verschlingt die letzten Naturräume. Wildnis wird immer mehr zur Seltenheit. Zusätzlich zerstört sich die moderne Menschheit selbst. Isoliert und durch soziale Medien kaputt kommuniziert, verschwindet für immer mehr Menschen der Boden unter den Füßen. Hannah Arendt hat die Verlorenheit in der Massengesellschaft präzise und treffend analysiert. Martin Heidegger hat die Probleme der Technik auf den Punkt gebracht und Denker wie Lewis Mumford konnten aufzeigen inwiefern die moderne urbane Welt ihre Bewohner vereinzelt. Paul Shepard und John Zerzan haben – basierend auf den Erkenntnissen der archäologischen Forschung der letzten 50 Jahre – eine tiefgreifende Gesellschaftskritik formuliert, welche für die Band und mich persönlich von großer Bedeutung ist.
Die empfundene Machtlosigkeit und die entstandene Wut über die oberflächliche und völlig inhaltsleere Alltagswelt der meisten Menschen und die tiefe Trauer um den Verlust der natürlichen Welt sind die Hauptinspirationen bzw. Triebkräfte hinter Bonjour Tristesse. Der Rückzug in die Berge und Wälder ist für mich heilsam. Wenn man sie zu finden weiß, dann birgt die Natur auch in einer hektischen, engen, lauten und verlogenen Welt noch immer Orte der Einkehr und Ruhe.

Deine Musik vermittelt ein starkes Gefühl der Entfremdung und existenziellen Verzweiflung. Wie reflektiert dies deine eigene Sicht auf die Welt und auf das moderne Leben? Siehst du in der Musik auch eine Art kathartische Befreiung von diesen Gefühlen?
Du triffst es auf den Punkt. Sowohl was die Entfremdung und existenzielle Verzweiflung betrifft, als auch damit, dass die Musik von Bonjour Tristesse ein notwendiges Ventil darstellt um angestauten Emotionen Ausdruck zu verleihen. Es klingt eigenartig, aber die Stücke sind für mich eine Form von selbst angefertigter Medizin, die mich die Welt besser ertragen lässt. Ich denke, dass ich ohne Black Metal eine deutlich kaputtere Existenz wäre. Insofern steckt in der depressiven und negativen Musik von Bonjour Tristesse auch ein Element der Heilung und der positiven Weltbeziehung.
Wie bereits angeklungen sein durfte, kann ich bezüglich der modernen Welt kaum positive Worte finden. Der angebliche Siegeszug des Fortschritts ist für mich vielmehr eine Geschichte des Niedergangs. Es ist unmöglich in einem Interview eine komplette Weltsicht gebührend auszuformulieren, daher fasse ich diese stark (!) verkürzt zusammen: Der Mensch lebte viele Jahrzehntausende als Tier unter Tieren in einer Welt der unberührten Naturräume. Dieses Leben war kein prekäres von Leid geprägtes, wie es „Denker“ wie Thomas Hobbes dargestellt haben. Die archäologische Forschung ist sich heute weitgehend darüber einig, dass das menschliche Leben in der Frühgeschichte vielmehr durch persönliche Freiheit, echte Gemeinschaft und stabile Sozialstrukturen in Familienbanden bzw. Stammesgefügen und egalitäre Geschlechterverhältnisse geprägt war. Es stand viel Zeit zur freien Verfügung und echte Begegnungen zwischen Menschen und den Elementen der Natur waren möglich. Mit dem Beginn der Landwirtschaft begann der Mensch sich als Herrscher über die Natur aufzuschwingen. Wo er vorher als ein Element unter vielen in die natürlichen und ökosystemaren Kreisläufe eingebunden war, beherrschte er nun die Landschaften, drückte der Umwelt seinen Willen auf und bezahlte selbiges mit einem Leben voll Arbeit, Unfreiheit und Krankheit. Nichtsdestotrotz konnten durch die Landwirtschaft Nahrungsüberschüsse erwirtschaftet werden. Die Folge waren Bevölkerungswachstum und soziale Ungleichheit, denn in den entstehenden Ballungszentren der ersten Städte bildeten sich schnell reiche Eliten aus, die die ärmeren Bevölkerungsteile genauso wie das Land unterwarfen und kontrollierten.
Mit der Aufklärung vollzog sich dann einerseits eine verstärkte Emanzipation des Menschen, andererseits auch eine tiefgreifende Entzauberung der Welt, die nun berechnet und letztendlich in totaler Weise verwaltet und umgeformt wurde. Die Dialektik der Aufklärung wurde von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer hervorragend analysiert.
Spätestens mit der Industrialisierung wurde die Zerstörung der natürlichen Welt in einem bis dato unbekannten Maß forciert. Heute leben wir auf einem technisch massiv überformten, überbevölkerten Planeten, auf dem durch repressive Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme massive Ungleichheiten erzeugt werden. Das „Projekt des Fortschritts“ kann als gescheitert betrachtet werden. Technologische „Problemlösungen“ brachten bisher und werden auch zukünftig viele weitere Probleme mit sich bringen. Einen wirklichen Ausweg, der ethisch akzeptabel wäre und sowohl eine Befreiung des Menschen, als auch der natürlichen Welt mit sich bringt, sehe ich nicht.
Das Erleben der Natur und die Momente im Austausch mit ihrer Andersartigkeit könnten nach wie vor große Lehrmeister des Menschen sein. Dieser Pfad gerät allerdings immer mehr in Vergessenheit. Jene indigenen Gemeinschaften, die diesem Weg noch heute folgen, werden weiterhin zerstört und von vielen als rückständig betrachtet. Die künstliche, von technischer Überformung der Natur geprägte Welt des modernen Menschen ist eine illusionäre, destruktive Zerstörungsmaschine. Echte Freiheit und wirkliche Sinnhaftigkeit findet sich abseits der selten gewordenen, von Menschen unberührten Wildnis heute kaum mehr.
Der Titel „The World Without Us“ deutet auf eine post-apokalyptische Welt hin, in der die Natur sich die Erde zurückholt. Welche Rolle spielt diese Vision der „Befreiung“ der Natur in deiner persönlichen Philosophie? Ist es ein unausweichliches Schicksal oder ein moralisches Urteil über die Menschheit?
Mich interessiert eine zentrale ethische Fragestellung: Kann es richtig sein, dass der Planet (wie von der Bibel propagiert) nur für eine Spezies, namens Mensch, da ist und diese damit verfahren kann wie sie möchte? Ich denke, dass diese Weltsicht eine der treibenden Zerstörungskräfte in der Geschichte des Menschen ist. Wir sollten als eine Art unter unzähligen anderen Lebensformen leben und das nicht-menschliche bzw. andersartige respektieren. Eine Zukunft in der sich die Kräfte der Natur und damit die zahlreichen nicht-menschlichen Arten die Erde zurückgeholt haben, eine Erde auf der dann evtl. weniger Menschen existieren bzw. nur mehr jene, die gelernt haben im Einklang mit der Natur zu leben, ist unter Umständen keine ausschließlich düstere Zukunftsvision, vielmehr kann sie auch einen Hoffnungsschimmer und einen Hauch Gerechtigkeit beinhalten.
Ich denke aber, dass man differenzieren sollte was genau man mit „Menschheit“ meint. Die industrialisierten Zivilisationen sind ein deutlich destruktiverer Faktor, als beispielsweise indigene Gemeinschaften am Amazonas. Es gibt wirtschaftliche, soziale und ökologische Ungleichheit und die daraus resultierenden Unterschiede zeigen sich unter anderem im etablierten Lebenswandel und dem Mensch-Natur-Verhältnis.
Ich denke die imperiale Lebensweise des Westens (wie sie von Brand und Wissen beschrieben wurde) sollte verurteilt werden. Allerdings ist es auch dabei schwierig einzelne Individuen zu verurteilen, wir leben schließlich alle in einer Welt der Zwänge und Adorno hatte recht, als er in „Minima Moralia“ schrieb, dass es „kein richtiges Leben im falschen“ gibt.
In deinen Texten und Musik scheinst du eine intensive Ablehnung der modernen Zivilisation und der industriellen Welt zu thematisieren. Wie prägt diese Sichtweise deine Alltagsentscheidungen und dein persönliches Leben? Gibt es einen Weg, sich dieser Realität zu entziehen, oder ist die Verzweiflung unausweichlich?
Wie gesagt, es gibt kein richtiges Leben im falschen. Die Verzweiflung bleibt unausweichlich. Das ist die Grunderkenntnis des Daseins in der Moderne bzw. Postmoderne. Allerdings sollte man es sich auch nicht zu einfach machen. Viele ziehen aus dieser Erkenntnis den Schluss, dass alles egal ist, dass jegliches Verhalten in Ordnung geht. Das halte ich für eine unzureichende Erkenntnis und Zeugnis eines schwachen bzw. unreflektierten Charakters. Unabhängig davon, wie realistisch es tatsächlich ist die Welt zum Positiven zu verändern, man sollte zumindest im persönlichen Umfeld versuchen ein „guter Mensch“ zu sein und kritisch durch ein Leben gehen, welches auf Respekt und Empathie begründet ist. Die Welt um uns herum macht das zu keinem leichten Unterfangen, dennoch ist es den Versuch wert.
Der Einfluss von Philosophen wie Fredy Perlman und Anarcho-Primitivismus ist in deiner Musik spürbar. Wie verbindest du diese philosophischen Ideen mit der Schaffung deiner Songs? Glaubst du, dass Musik eine Plattform sein kann, um diese radikalen Ideen zu verbreiten?
Die Verbindung entsteht oftmals schlicht und ergreifend durch Inspiration. Ich lese Texte, die mein Denken beeinflussen. Dabei kann eine neue Erkenntnis inspirierend sein, mich zur Gitarre greifen lassen und zur Entstehung eines Songs führen.
Ich denke schon, dass Musik bestimmte Philosophien verbreiten kann. Ob das etwas an dominanten Diskursen bzw. dem Status quo ändert ist wieder eine andere Frage. Dennoch finde ich es wertvoll bestimmte Gedanken und Sichtweisen mit anderen zu teilen. Ich kann jedem beispielsweise empfehlen Perlman's „Against His-story, Against Leviathan“ und Zerzan's „Future primitive“ zu lesen. Als Einstieg in das zivilisationskritische Denken würde ich Henry David Thoreau's „Walden“ und Daniel Quinn's „Ishmael“ empfehlen. Ich war schon immer von einem großen Erkenntnisinteresse getrieben und wollte wissen, warum die Welt so (kaputt) ist, wie sie ist. Die genannten Bücher haben für mich allesamt neue Türen geöffnet und mir Denkimpulse gegeben.
Man sollte aber bei all der Theorie nicht vergessen, dass sich das Leben (größtenteils) nicht in Büchern abspielt und dass bedeutungsvolle Erfahrungen im Zusammenleben mit anderen Menschen bzw. in Interaktion mit der Natur von einer ganz anderen Qualität sind. Der Soziologe und Metaller Hartmut Rosa beschreibt die Natur als eine der wichtigsten Resonanzsphären des Menschen, notwendig um eine gelungene Weltbeziehung aufzubauen. Das halte ich für sehr überzeugend. Dafür nutzt es aber nichts nur über die Natur zu lesen, man muss sich auf den Weg machen und sich in die Welt begeben.
Dein Songwriting wird oft als roher Ausdruck von Wut und Verzweiflung beschrieben. Welche Rolle spielt Spiritualität oder Transzendenz in deinem kreativen Prozess? Gibt es in deiner Musik eine Suche nach etwas Höherem, oder ist es eher eine Konfrontation mit der Leere?
Es ist sowohl eine Konfrontation mit der Leere, als auch, in gewisser Weise, die Suche nach etwas „Höherem“. Ich glaube nicht an göttliche Wesenheiten, wenn es etwas „Höheres“ gibt, dann wäre das für mich die natürliche Welt, die es ganz ohne Geister und religiöse Dogmen schafft uns in einen größeren Kontext einzubetten, der sinnstiftend und wertvoll ist. Bei Bonjour Tristesse geht es aber weniger um diese Art von Naturbezug, sondern eher um die Auseinandersetzung mit der Leere, die der modernen Welt und unseren Leben innewohnt.

Du beschreibst in deinen Texten eine Welt, in der die Menschheit ihren eigenen Untergang herbeiführt. Gibt es für dich eine Möglichkeit, diese zerstörerischen Tendenzen zu überwinden, oder betrachtest du dies als unvermeidliche Konsequenz der menschlichen Natur?
Ich könnte eine lange Antwort auf diese Frage formulieren, möchte mich aber ausnahmsweise kurz fassen:
Es lohnt, denke ich, über folgenden Zusammenhang nachzudenken: Auf einem Planeten, dessen Ressourcen endlich sind, kann es kein endloses Wachstum geben. Ändern wir nichts am Status quo, so erreichen die verschiedenen Ausprägungen des Wachstums irgendwann eine Grenze, welche den etablierten Lebenswandel zum stoppen und nicht nur Ökosysteme, sondern auch die menschlichen Gesellschaften zum kollabieren bringen wird. Ich fände es daher wichtig sich ernsthaft mit diesen Zusammenhängen zu befassen und bereits jetzt das Verhältnis zur Natur zu überdenken, die globalisierte Wirtschaftsweise zu verändern und Stück für Stück auf eine Lebensweise hinzuarbeiten, die vielleicht deutlich weniger Luxus und Bequemlichkeit ermöglicht, aber eben nicht zu einem plötzlichen Untergang mit Gewalt, Elend und globalem Leid führt. Sehr wahrscheinlich ist es für so einen Richtungswechsel bereits zu spät...
Ich denke im Übrigen nicht, dass die angesprochenen „zerstörerischen Tendenzen“ ihren Ursprung in so etwas wie der „Natur des Menschen“ haben. Die Geschichte hat gezeigt, dass es auf der Erde nicht nur eine Art und Weise zu leben gibt. Der Mythos des Fortschritts beginnt mit der neolithischen Revolution, dem Beginn des Ackerbaus, vor etwa 10.000 Jahren. Dessen Erbe ist die momentan vorherrschende imperiale, industrialisierte Lebensweise. Die Menschheit lebt allerdings seit mindestens 200.000 Jahren auf der Erde. Den überwiegenden Teil lebten wir als Jäger und Sammler und praktizierten eine völlig andere Lebensweise, welche keineswegs zu Naturzerstörung, Ungleichheit, sozialer Isolation und hoffnungslosem Leid führte. Die Zerstörungstendenzen sind also kein unausweichliches Element der „Natur des Menschen“, sondern vielmehr ein unausweichliches Element der technologisierten und industrialisierten Wirtschaftsweise bzw. des auf Profitmaximierung und Konsum zielenden Lebensstils in der etablierten kapitalistischen Massengesellschaft.
In „Against the Grain“ äußerst du eine klare Abkehr von der modernen Welt und ihren destruktiven Kräften. Siehst du eine Möglichkeit für Rebellion gegen dieses System, oder steht dein Werk als eine Art Abschiedsgesang auf die Menschheit und ihre Unfähigkeit, den Kurs zu ändern?
Abschied, Weltschmerz und Niedergang sind allesamt elementare Bestandteile meiner Musik. Die Hoffnung ist ein Gefängnis.
Welche Richtung planst du mit Bonjour Tristesse in der Zukunft einzuschlagen? Kannst du dir vorstellen, musikalisch oder thematisch neue Wege zu gehen, oder bleibst du weiterhin der düsteren, naturverbundenen Philosophie und deiner kompromisslosen musikalischen Ausdrucksweise treu?
Die ersten Stücke des nächsten Albums sind bereits fertiggestellt und ich kann versprechen, dass die eingeschlagene musikalische Richtung weiter in den Abgrund der Finsternis führt.
Vielen Dank für die tiefen Einblicke in dein Schaffen!